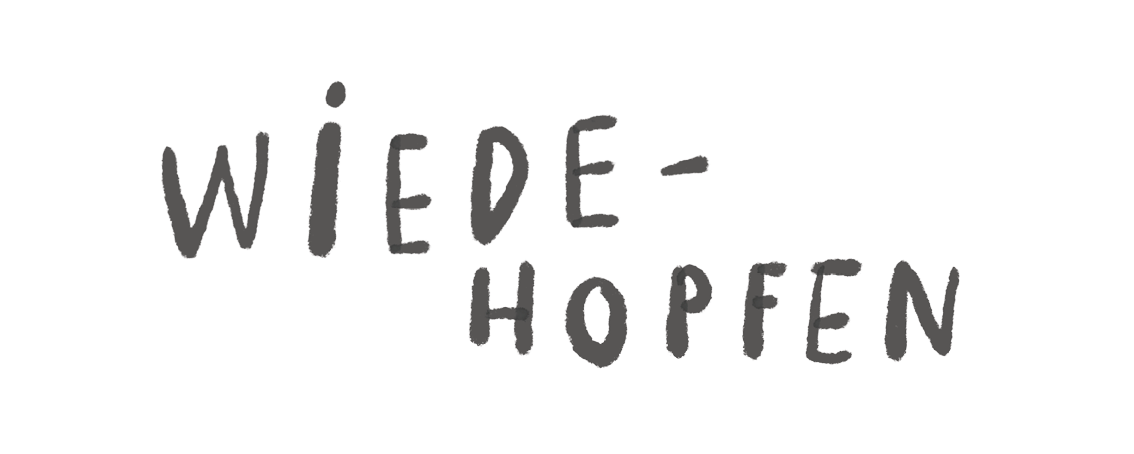Der Wiedehopf
Schwarz und weiß gestreift kommt er daher, mit gebänderten Flügeln und einem ebenso gebänderten Schwanz, was besonders während seines schmetterlingshaften Fluges auffällt. Brust und Kopf sind orangebräunlich bis erdfarben, was ihm zugutekommt: denn so ist der Wiedehopf am Boden gut getarnt. Und dort findet er seine Leibspeise: Großinsekten wie Grillen und Grashüpfer, am liebsten Maulwurfsgrillen, aber auch Raupen und Käfer, die er mit seinem langen, leicht gebogenen Schnabel geschickt aufspürt und fängt.
Doch der Wiedehopf hat ein Problem. Denn diese großen Insektenarten, auf die er spezialisiert und angewiesen ist, gibt es vielerorts nicht mehr. Sie brauchen warme, sandige Böden, Brachland und mageren Rasen. In unserer aufgeräumten Welt und unserer auf maximalen Ertrag getrimmten Kulturlandschaft sind diese Flächen rar - und damit auch die Nahrungsgrundlage für den Wiedehopf. Und wo Nahrung fehlt, fehlt auch er.
Der Wiedehopf ist Höhlenbrüter und zieht seine Jungen am liebsten geschützt in alten Baumhöhlen oder Mauerlöchern auf. Auf den Balearen, wo er noch häufiger vorkommt, brütet er in alten Olivenbäumen oder Hohlräumen in Steinmauern, die die dortige Kulturlandschaft auszeichnen. Solche Strukturen sind bei uns selten geworden; die Flurbereinigung in der Landwirtschaft, die immer größere Felder und Äcker zur Folge hatte, bietet keinen Platz mehr für Hecken, Grenzwälle, Mauern und knorrige Bäume.
Die Folge: In weiten Teilen Deutschlands ist der Wiedehopf ausgestorben. Selbst in warmen Regionen, die klimatisch zu ihm passen würden, hat die konventionelle Landwirtschaft in den vergangenen Jahren die Strukturen so stark verändert, dass weder Nahrung, noch Nistmöglichkeiten für den Wiedehopf vorhanden sind.
Doch es gibt Hoffnung! Ausgehend von stillgelegten Truppenübungsplätzen und ehemaligen Braunkohle-Abbaugebieten in Ostdeutschland kann der Vogel des Jahres 2022 langsam sein Vorkommen ausbauen. Brandenburg beherbergt inzwischen knapp die Hälfte aller deutschen Wiedehopfe, auch in der Altmark in Sachsen-Anhalt gibt es wieder stabile Populationen. Ostdeutschland hat somit eine besondere Verantwortung, die deutschen Bestände des Wiedehopfs zu sichern und ihm Möglichkeiten zu bieten, sich weiter auszubreiten. Genau da setzen wir an - und greifen dem Wiedehopf unter die Flügel. Auf dass bald sein herzerwärmendes „pu pu pu!“ wieder von sandigen Waldrändern, aus sonnigen Weinbergen und durch alte Obstbaumwiesen schallt.